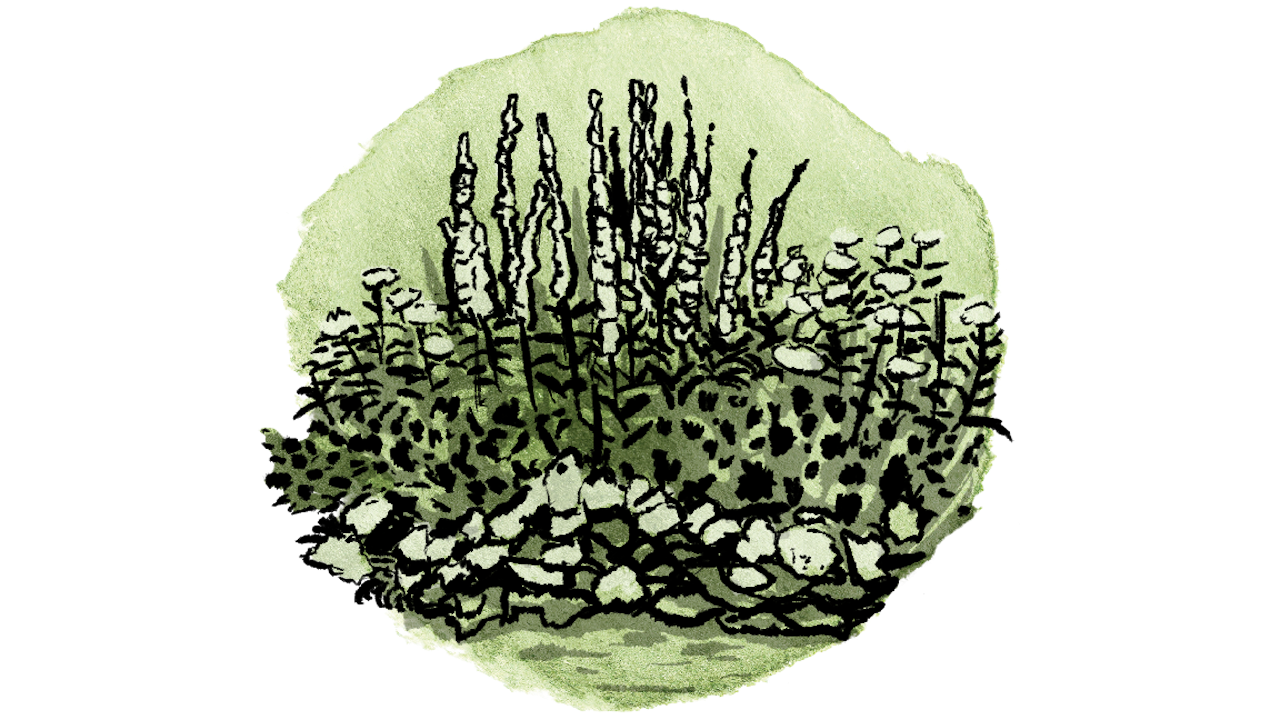Einheimische Wildstauden pflanzen
Pflanzen (Stauden, Gehölze)
Pflanzen (Stauden, Gehölze)
Betriebsgelände & Industriefl.
Beratung
Kleinstrukturen
Einheimische Wildstauden sind nicht nur eine farbenfrohe Augenweide für dich, sondern auch ein wertvoller Beitrag zur lokalen Artenvielfalt. Ob im Blumentopf, in der Balkonkiste oder direkt im Boden – mit wenig Aufwand schaffst du ein echtes Aufleben für Tiere und Pflanzen.
Auf meiner Merkliste speichern

Einheimische Wildstauden pflanzen – so förderst du Biodiversität im Garten oder auf dem Balkon
Einheimische Wildstauden sind für viele Insekten eine unverzichtbare Nahrungsquelle – vor allem für Wildbienen, Schwebfliegen und Schmetterlinge. Die meisten Arten sind mehrjährig, blühen jedes Jahr aufs Neue und schaffen so dauerhafte Lebensräume. Am besten kombinierst du die Wildstauden mit Gräsern aus deiner Region, dies erhöht die Artenvielfalt und zieht unterschiedliche Tiere an.
Wildstauden pflanzen
Pflanze, je nach Topfgrösse, drei bis vier Wildstauden. Kombiniere verschiedene Wildstauden mit einheimischen Gräsern für mehr Struktur und Vielfalt in deinem Garten oder auf dem Balkon.
Wildpflanzen gedeihen am besten auf nährstoffarmen Böden – Dünger und chemische Mittel schaden der Artenvielfalt.
Achte darauf, dass die Pflanzen zu den Licht- und Bodenverhältnissen passen – so wachsen sie nachhaltig und ohne Pflegeaufwand.
Diese Tiere profitieren von einheimischen Wildstauden im Garten
Mehrjährige Wildstauden bieten vielen Tierarten langfristig Nahrung und Lebensraum. Hier findest du eine Auswahl von Tieren, die besonders davon profitieren.
Eine Auswahl an Wildstauden, die besonders attraktiv und wertvoll für die Biodiversität sind
Der richtige Standort ist entscheidend: Nur wenn Licht, Boden und Feuchtigkeit zu den Wildstauden passen, entwickeln sie sich gesund – und bieten Insekten dauerhaft Nahrung und Lebensraum.
Was einheimische Wildstauen besonders wertvoll macht
Sie bieten Nahrung, Lebensraum und Schutz für unzählige Tiere – von Wildbienen über Schmetterlinge bis zu Vögeln und Käfern.
Sie sind robust, standortgerecht und benötigen keine aufwändige Pflege oder künstliche Bewässerung.
Sie blühen in verschiedenen Zeitetappen, bieten Struktur über alle Jahreszeiten hinweg – auch im Winter als Rückzugsort.
Sie schaffen ökologische Trittsteine im Siedlungsraum und verbinden Grünflächen miteinander.
Viele Insektenarten – wie Schmetterlingsraupen oder Wildbienen – sind auf ganz bestimmte Pflanzen angewiesen.
Einheimische Stauden bieten überdurchschnittlich viel verwertbaren Nektar und Pollen – besonders wichtig für Wildbienen & Co.
Sie fördern natürliche Kreisläufe und das Gleichgewicht im Garten – inklusive Nützlingsförderung (z. B. Marienkäfer, Spinnen).
Nach dem Anwachsen sind sie pflegeleicht, langlebig und werten jede Fläche ökologisch auf.
Ihre Vielfalt an Farben, Formen und Düften wirkt natürlich und ästhetisch – und lädt zum Entdecken ein.
Deine eigene Wildstauden-Oase schaffen
Aufwertung
Deine Wildstauden stehen bereits? Super! Mit ein paar einfachen Schritten kannst du sie noch wertvoller machen – für dich und für die Biodiversität:
Neuanlage
Wichtige Hinweise:
Töpfe müssen regelmässig gegossen werden
Im Beet reicht die richtige Standortwahl – dann braucht es kaum Wasser
Kombiniere dein Beet mit einheimischen Gräsern für noch mehr Vielfalt
Folge- und Begleitmassnahmen
Verschenke oder tausche Wildpflanzen an Freund:innen oder Nachbarn
Säe eine Wildblumenwiese auf einer grösseren Fläche
Kombiniere mit einem Sandarium, einer Insektentränke oder anderen Kleinstrukturen – das macht deinen Beitrag noch wirkungsvoller