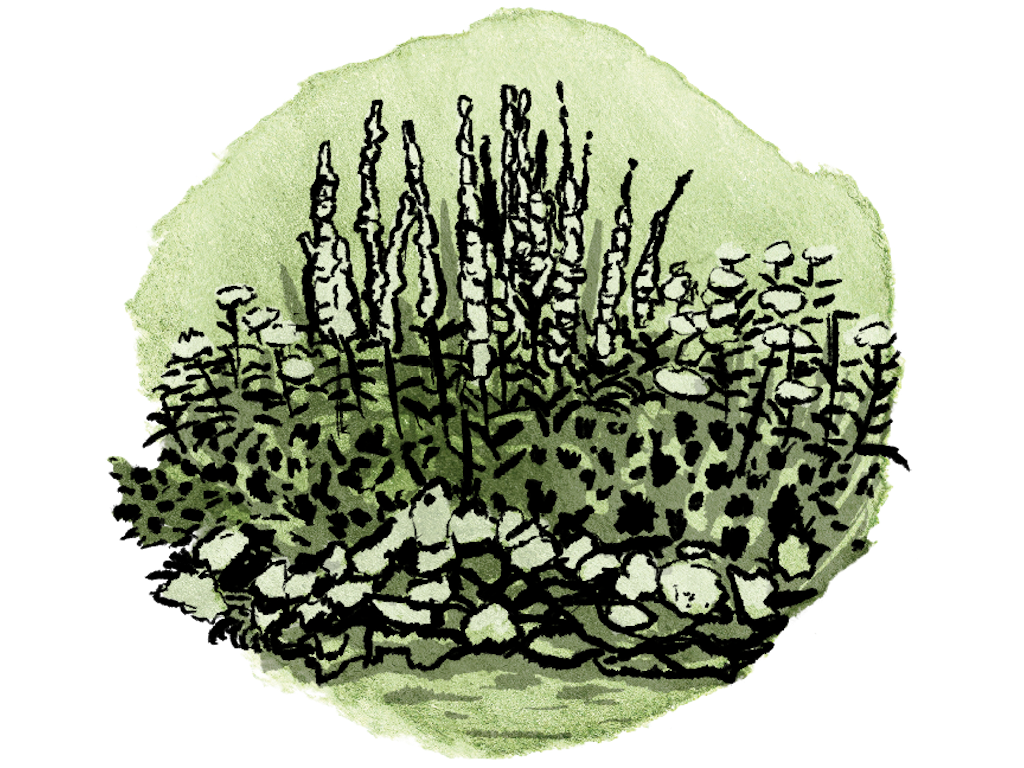Mit Totholz zu mehr Leben
Holz- und Steinstrukturen
Flechten
Insekten
Moose
Pflanzen (Stauden, Gehölze)
Totholz in jeglicher Form – vom umgefallenen Baum über den abgestorbenen Strauch bis hin zum Baumstrunk oder einem verbleibenden Wurzelstock – ist für die Biodiversität äusserst wichtig. Zahlreiche Tierarten, aber auch Moose, Flechten und Pilze profitieren davon.
Auf meiner Merkliste speichern

Diese Tiere und Pflanzen profitieren von Totholz
Mehrere Brutvogelarten bauen im morschen Holz Nisthöhlen oder nutzen bereits vorhandene Asthöhlen. Fledermäuse und andere Kleinsäuger nutzen natürliche Hohlräume unter der Rinde und Baumhöhlen als Tagesversteck, als Kinderstube oder für den Winterschlaf. Larven etlicher Käferarten nutzen Totholz als Nahrungsquelle, verschiedene Ameisen- und Bienenarten wohnen und nisten darin. Die grosse Insektenvielfalt in Totholz dient wiederum grösseren Tieren als willkommenes Nahrungsangebot. Zudem wird Totholz von Moosen und Flechten besiedelt. Am Abbau des Holzes sind holzzersetzende Pilze beteiligt. Beispiele für Organismenarten, die mit Totholz gefördert werden können:
Was Totholz besonders wertvoll macht
Grösse - Grosse Baum- und Wurzelstrünke zersetzen sich langsam und sind ein idealer Lebensraum für Pilze und holzbewohnende Insekten.
Liegend und stehend - Liegendes Totholz wird von Pilzen und Insekten bewohnt und dient gleichzeitig als Unterschlupf für Kleintiere (Säugetiere, Amphibien, Reptilien). Ein stehender, abgestorbener Baum, auch einer, der aus Sicherheitsgründen auf einer gewissen Höhe gekappt wurde, ist Lebensraum, Nahrungsquelle, Nistgelegenheit, Unterschlupf, Sitzwarte, Kinderstube und Vorratskammer für zahlreiche Arten.
Nachbarschaft zu naturnahen Lebensräumen - Befindet sich das Totholz in oder neben naturnahen Lebensräumen (z. B. Krautsaum, Wildhecke, andere Kleinstrukturen), dient es der Vernetzung und hilft, verschiedene Bedürfnisse der Tiere auf kleinem Raum abzudecken (z. B. Versteck und Nahrungssuche).
Alter - Bleibt das Totholz mehrere Jahre ungestört, wird es in den verschiedenen Zerfallsphasen von unterschiedlichen Arten genutzt.
Eine eigene Totholzstruktur schaffen
Gelegenheit nutzen
Lassen Sie wenn möglich abgestorbene Bäume, Sträucher und Baumstrünke stehen. Beachten Sie dabei unbedingt die Sicherheit: Totholz wird mit der Zeit brüchig! Wenn ein Baum gefällt werden muss, können Sie diesen auch in einer beliebigen Höhe (z. B. 3 m) fällen und den Rest stehen lassen. Sie können eine solche Totholzstruktur als Kletterhilfe für Efeu etc. nutzen.
Der Sturm hat in Ihrem Garten einen Baum gefällt oder ein grosser Ast ist heruntergefallen. Lassen Sie das Holz liegen oder deponieren Sie es an geeigneter Stelle.
Neuanlage - Totholzstrukturen planen und am richtigen Standort bauen
Stehendes Totholz können Sie auch ganz bewusst im Garten aufstellen: Grössere Holzstämme sollten Sie eingraben (Loch mit Wandkies füllen), kleinere Stammscheiben können Sie an geschützter Stelle aufstellen. In den Holzstamm können Sie einige Löcher bohren, so wird er rasch besiedelt.
Auch liegendes Totholz ist wertvoll. Verwenden Sie möglichst grosse Baumstämme, Wurzelstöcke oder auch alte Bohnenstangen. Sie können mit Totholzstämmen auch Beete einfassen oder «Skulpturen» errichten.
Brennholzstapel: Stapeln Sie an einem überdachten Standort mit Süd-Ost-Ausrichtung Holzscheite auf. Entfernen Sie Brennholz im Winter vorsichtig, es könnten sich Fledermäuse darin aufhalten.
Geräte und Maschinen (Neuanlage)
Säge
Spaten und Schaufel (Aufstellen von Totholz)
Totholz richtig pflegen – für dauerhafte Biodiversität
Es ist keine Pflege nötig, das Totholz wird dem Zerfall überlassen. Kontrollieren Sie bei stehendem Totholz (Baumstämme) regelmässig die Sicherheit.
Achtung: wie man beim Bau einer Totholzstruktur Tiere und Pflanzen schützt
Kein Holz invasiver Neophyten verwenden (Robinie, Götterbaum, Kirschlorbeer), da die Wahrscheinlichkeit gross ist, dass es ausschlägt.
Pflegen Sie Randbereiche um Kleinstrukturen von Hand, mähen Sie nicht mit dem Rasenmäher bis an die Struktur. Verzichten Sie auf die Verwendung einer Motorsense (Fadenmäher). Fadenmäher gefährden bodennahe Tiere.
Quellen und weiterführende Informationen:
Lachat T. et al. (2019):«Totholz im Wald, Entstehung, Bedeutung und Förderung», Merkblatt für die Praxis Nr. 52