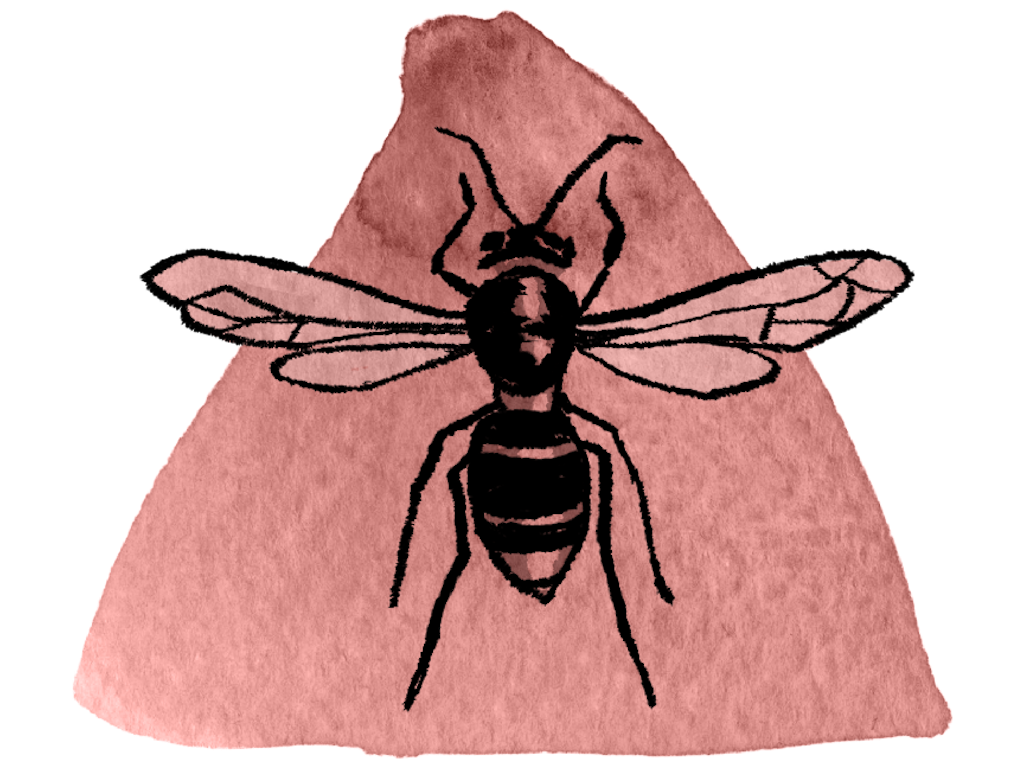Vernetzte Lebensräume – der Schlüssel zur Stadtnatur
Grundlagen zur Biodiversität
Artikel & Fachartikel
Ein Lebensraum, auch Biotop genannt, ist der Ort, wo eine bestimmte Lebensgemeinschaft aus Pflanzen und Tieren vorkommt. Fördert man einen Lebensraum, fördert man dabei auch die darauf spezialisierten Arten.
Auf meiner Merkliste speichern

Wie Lebensräume zusammenwirken: Bestäubung, Bodenfruchtbarkeit und weitere Ökosystemleistungen
Die Organismen und Populationen in den verschiedenen Lebensräumen stehen in Kontakt miteinander, sie fressen, jagen und profitieren voneinander. So bestäuben zahlreiche Insekten die farbenfrohen und nektartragenden Blütenpflanzen und erlauben dadurch deren Fortpflanzung. Die aus der Befruchtung entstandenen Samen oder Früchte werden wiederum von Insekten, Vögeln, Säugern oder auch dem Menschen verspeist, was gleichzeitig zur Ausbreitung der Pflanzenart beiträgt. Tiere und Pflanzen werden von physischen Elementen wie dem Klima , dem Boden oder dem Wasserhaushalt beeinflusst und üben selber einen Einfluss auf ihre Umwelt aus. Die Bestäubungsleistung von Insekten, die Fruchtbarkeit des Bodens (dank unzähligen Mikroorganismen, Pilzen oder auch Regenwürmern) die Schönheit einer wilden Berglandschaft oder der kultivierten Hügel des Mittellandes werden Ökosystemleistungen genannt: Sie tragen zum Wohlergehen der Menschen bei.
Warum spezialisierte Arten verschwinden
Pflanzen brauchen Licht, Wasser, Nährstoffe. Wenn davon zu viel oder zu wenig vorhanden ist, verschwinden die häufigen Arten und es gibt Platz für spezialisierte Arten, die sich an schattige, trockene, nasse oder magere Standorte angepasst haben. Das schweizerische Mittelland weist heute grossflächig nährstoffreiche, ausreichend mit Wasser versorgte Verhältnisse auf. Dies liegt vor allem an der intensiven Landwirtschaft. Standorte für die Spezialisten gibt es nur noch wenige.
Besondere Standortbedingungen
Schaffe besondere Lebensräume, also magere, trockene, nasse, oder wechselfeuchte Standorte. Dies unterstützt das Überleben spezialisierter Arten und schafft Vielfalt.
Warum Lebensräume Zeit brauchen
Die meisten Lebensraumtypen brauchen viele Jahre, bis sie ihren vollen Wert entfalten. Es braucht Zeit:
bis Gehölze gross geworden sind, den Lebensraum prägen, aber auch mit Rindenstruktur, Wurzelwerk und Totholzbereichen selber einen Lebensraum darstellen,
bis Tiere von aussen den Lebensraum gefunden haben und nutzen,
bis sich eine dem Standort und der Pflege entsprechende stabile Gemeinschaft gebildet hat.
Wenn Lebensräume jahrzehntelang auf ähnliche Weise gepflegt und genutzt werden, kann sich eine Fauna halten, die sonst weitgehend verschwunden ist. Ein Beispiel dafür ist das Grosse Glühwürmchen, das innerhalb des Siedlungsgebiets praktisch nur noch in alten Friedhofsbereichen vorkommt. Da nur die geschlechtsreifen Männchen flugfähig sind, ist die Art wenig mobil und erreicht neue Lebensräume sehr schlecht.
Alter und Dynamik
Es ist besser, einen alten naturnahen Bereich oder Lebensraum im Garten zu belassen und aufzuwerten, als ihn an einem anderen Ort neu anzulegen.
Einen alten Baum mit Höhlen und allenfalls Efeu sollte man stehen lassen, solange es sicherheitstechnisch möglich ist.
Eine Ausnahme von dieser Regel bilden die dynamischen Vegetationstypen wie Pioniergesellschaften und Ruderalfluren. Im schweizerischen Mittelland sind alle jungen, sich laufend verändernden Biotoptypen selten geworden. Hier ist jeder Quadratmeter einer bestimmten Nutzung oder Gestaltung zugeordnet und wird so gepflegt, dass das auch so bleibt. Im eigenen Garten hingegen kann man dynamische Lebensraumtypen unterstützen.
Wertvoller als die Summer der Einzellebensräume: Das Mosaik
Grundsätzlich gilt: Je grösser ein naturnaher Lebensraum, desto stabiler ist er. Grössere Populationen sind weniger von Inzuchteffekten und damit weniger vom Aussterben bedroht. Im Siedlungsgebiet findet man jedoch selten typisch ausgebildete, grosse naturnahe Lebensräume. Insbesondere in Gärten sind diese meist nur klein. Dafür sind sie oft in einem kleinräumigen Mosaik ineinander verzahnt. Dies hat einen eigenen Wert und macht sogar die besondere Bedeutung des Siedlungsgebiets aus. Wenn unterschiedliche naturnahe Lebensräume auf engem Raum nebeneinander liegen, steigert sich der ökologische Wert um ein Vielfaches: Neben den typischen Arten des jeweiligen Lebensraums können auch Arten vorkommen, welche auf Übergänge spezialisiert sind oder in ihrem Lebenszyklus mehrere Lebensraumtypen benötigen. Die im Siedlungsgebiet verbreiteten Bergmolche brauchen beispielsweise:
Teiche zur Entwicklung von Eiern und Larven,
Krautsäume, Gehölze und Dickichte als Landlebensraum,
viel liegendes Totholz, Holzbretter oder andere Unterschlupfstrukturen als Verstecke vor Fressfeinden und als Nahrungsquelle
nahe gelegene, gut erreichbare unterirdische Unterschlüpfe als Winterquartier wie z.B. Trockenmauern, Asthaufen, Steinlinsen etc.
Für den Siedlungs-/Stadtgarten gilt deshalb: Es ist besser, mehrere unterschiedliche, aneinander angrenzende Lebensräume anzulegen als einen einzigen Biotoptyp. Es ist besser, eine kleine Wildhecke mit Saum, eine Wildnis-Ecke und ein Stück Wiese anzulegen, als die ganze Fläche zu einer einzigen grossen Wiese umzugestalten.
Trittsteine kombinieren, Vielfalt fördern
Lege verschiedene, aneinander grenzende Lebensraumtypen an, sodass ein kleinräumig verzahntes Mosaik an Flächen mit verschiedenen Standortbedingungen entsteht. Oder ergänze bestehende Lebensräume mit Kleinstrukturen.
Versiegelte Flächen: Barriere für Natur und Klima
Auf einer versiegelten Fläche sorgt ein harter Belag wie Asphalt oder Beton dafür, dass kein Regenwasser versickern kann. Die Verbindung zwischen Boden und Oberfläche ist in beide Richtungen unterbrochen und auf der Oberfläche kann nichts wachsen. Es gibt Zwischenstufen:
Eine Fläche mit Sickerbeton, Saibro, Stabilizer oder Ähnlichem ist zu einem gewissen Grad für Regenwasser durchlässig. Sie gilt trotzdem als versiegelt, da sie sich nicht begrünt und kein Potenzial als Lebensraum hat.
Eine Rasenfläche über einer Tiefgarage ist begrünt und kann einen Lebensraum darstellen. Sie gilt jedoch als versiegelt, da der Zugang zum gewachsenen Boden fehlt und das Regenwasser nicht versickern kann.
Asphaltierte Flächen sind tot, sie haben kein Entwicklungspotenzial (ausser sie werden aufgebrochen). Sie bilden eine unter- und oberirdische Barriere für viele Tierarten und sie heizen das Stadtklima auf.
Versiegelte Flächen
Beschränke die Versiegelung auf das funktionelle Minimum: Versiegel nur neu oder lass nur die Flächen versiegelt, die wirklich nötig sind. Vielleicht wird der asphaltierte Zugang zum Haus dann nur 1 m breit. Denke in neuen Kategorien.
Verzichte möglichst auf die Unterbauung von Freifläche.
Quellen:
Tschäppeler & Haslinger, Praxishandbuch Stadtnatur 2024, Haupt Verlag
Forum für Biodiversität, SCNAT, Mehr als Artenvielfalt