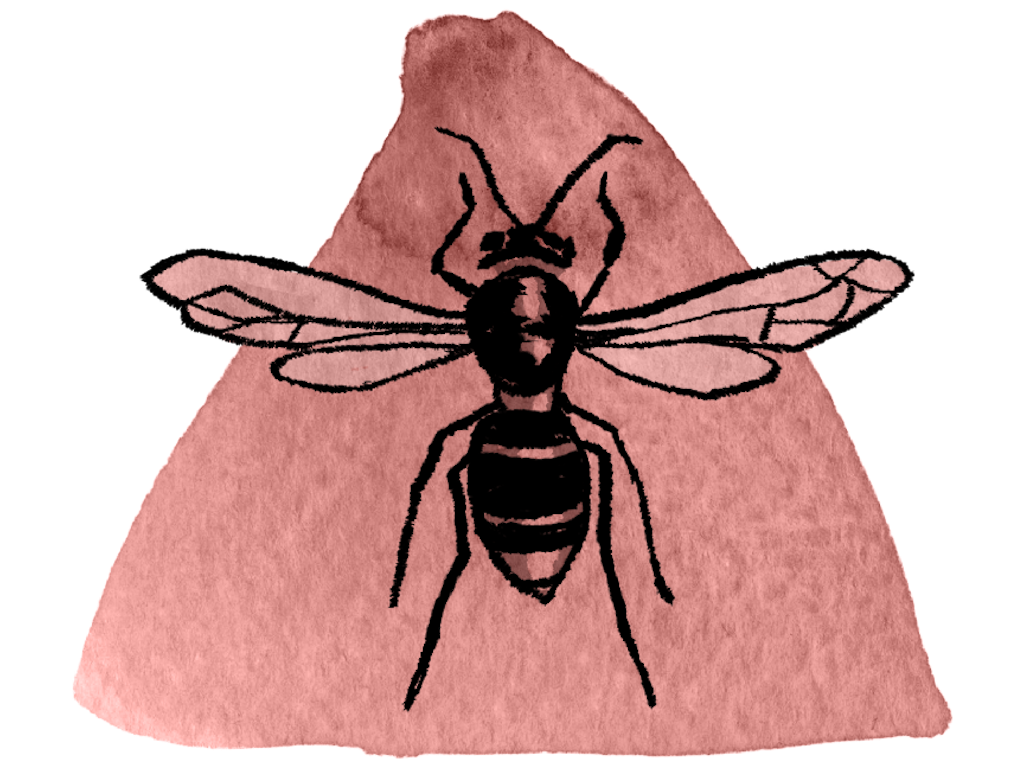Bewahrung der Schöpfung: Traditionen und Artenvielfalt
Faszination Biodiversität
Artikel & Fachartikel
Partner:innen
In vielen Religionsgemeinschaften bestehen Traditionen zu einem schonenden Umgang mit der Natur. Religion und Nachhaltigkeit sind eng miteinander verbunden. Der Glaube kann eine tief verankerte Kraft sein, um sich für Klimaschutz und Artenvielfalt zu engagieren.
Auf meiner Merkliste speichern

Glaube und Bewahrung der Natur
In vielen Religionen und religiösen Traditionen besteht eine enge Verbindung zwischen dem Glauben und der Verantwortung für die Natur. Weltweit betonen Religionen die Verbindung des Menschen mit der Natur und übertragen dem Menschen eine Verantwortung für den Klimaschutz und die Nachhaltigkeit. Angesichts der Tatsache, dass sich der weitaus grösste Teil der Menschen weltweit einer Glaubensgemeinschaft zugehörig fühlt, wird deutlich, welches Potenzial darin für eine nachhaltige Zukunft liegt.
Diese gemeinsame Verantwortung zeigt sich insbesondere im interreligiösen Dialog und in gemeinsamen Initiativen zum Schutz der Umwelt. Im September 2024 haben beispielsweise Papst Franziskus und Grossimam Nasaruddin Umar aus Indonesien eine gemeinsame Erklärung unterschrieben, in der sie dazu aufrufen, «die Unversehrtheit des Ökosystems und seiner Ressourcen zu bewahren, die wir von früheren Generationen geerbt haben und die wir an unsere Kinder und Enkelkinder weitergeben wollen.»
Welchen Beitrag kann Glaube also zur Bewahrung der Natur beitragen?
Unterschiedliche Perspektiven
Es gibt in den Religionen verschiedene Ansätze, welche eine aus dem Glauben heraus gewachsene Verbindung zur Natur und zu deren Bewahrung schaffen können.
Heiligkeit: Lebensräume, Naturdenkmäler, Gewässer, Tiere oder Pflanzen können für Glaubensgemeinschaften heilig sein. Für buddhistische Mönche haben Bäume eine besondere Bedeutung. In Thailand wurden sie mit einer Tree Ordination heilig, um sie so vor dem Abholzen zu schützen. In der Spiritualität von indigen Gemeinschaften wird die Erde teilweise als Ganzes als Organismus betrachtet. So erhalten Naturstätten oder Lebensräume wie Flüsse einen eigenen Rechtsstatus. Sie dürfen damit nicht ausgebeutet werden, sondern müssen geachtet werden. An gewissen Orten wie in Äthiopien sind Kirchenwälder als biodiverse Hotspots neben kargen Graslandschaften erhalten geblieben.
Eine Frage der Gerechtigkeit: Viele Religionen betonen ausserdem soziale Aspekte und Gerechtigkeitsfragen. Menschen aus ärmeren Ländern sind stärker von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen, als dass sie selbst dazu beigetragen haben. In diesem Sinn wird der Einsatz gegen den Klimawandel auch eine globale Gerechtigkeitsfrage, damit ein Leben für alle Menschen in Würde überhaupt möglich wird.
Rolle und Perspektive des Menschen auf Erden: Ein anderer Berührungspunkt liegt darin, dass Religionen die Rolle, Aufgabe und Beziehung des Menschen zur Natur mit einem zusätzlichen transzendenten Aspekt – dem Heiligen, dem Göttlichen – ergänzen. Dadurch verändert sich auch die Perspektive des Menschen auf seine Umwelt und eine neue Wertzuschreibung wird möglich. Die Umwelt wird zur Mitwelt und die Natur wird mit dem Menschen in gegenseitige Verbindung gesetzt. Das Göttliche oder die Transzendenz rücken ins Zentrum des Weltbildes. Das schmälert nicht die besondere Verantwortung des Menschen im hier und jetzt, richtet die Perspektive aber neu aus. In der islamischen Tradition gibt es das Konzept «Khalifa», das den Menschen als Stellvertreter Gottes auf Erden erklärt, in dessen Verantwortung es liegt, die Schöpfung zu schützen. Diese unterschiedlichen Perspektiven verdeutlichen eine übergeordnete Botschaft: Der Natur ist ein Heiligtum, das es zu bewahren gilt.
Diese Aspekte können dazu führen, dass Glaubensgemeinschaften eine bewahrende Perspektive auf die Mitwelt einnehmen. Dazu gibt es verschiedene religiöse Traditionen, Rituale oder Gebote – die heute in einem westeuropäischen Kontext meistens als negativ oder einschränkend wahrgenommen werden –, die beim Einüben dieser Perspektive helfen können. Sie sind mögliche Leitlinien, um einerseits das Zusammenleben als Gesellschaft und Gemeinschaft zu gestalten (bspw. das Zusammenleben in einer klösterlichen Gemeinschaft). Andererseits können sie Hilfestellungen für die persönliche Identität bieten. In vielen Religionen gibt es Traditionen, die dazu einladen, Verzicht zu üben (bspw. über das Fasten), sich Zeit für die innere Einkehr zu nehmen (bspw. beim Pilgern oder bei Exerzitien) oder sich in Achtsamkeit zu üben (bspw. über Meditation).
Christliche Perspektive
Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind für die Kirchen kein Trendthema. Ein wichtiger Meilenstein war die Erste Europäische Ökumenische Versammlung in Basel im Jahr 1989 mit den zentralen Anliegen Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Das Thema hat mit Papst Franziskus und seiner Umweltenzyklika Laudato Si‘ aus dem Jahr 2015 nochmals deutlich an Bedeutung gewonnen. Er beschreibt darin seine «Sorge um das gemeinsame Haus».
In der jüdisch-christlichen Tradition findet sich der Auftrag zur Bewahrung der Schöpfung schon ganz am Anfang der Bibel im Buch Genesis. Der Mensch wird als Verwalter der Erde beschrieben, der für deren Pflege und Schutz zuständig ist. Papst Franziskus widerspricht klar der Darstellung, die Erde sei durch den Menschen zu unterwerfen (vgl. Gen. 1,28). Dazu schreibt er in Laudato Si’ 67: «Das ist keine korrekte Interpretation der Bibel, wie sie die Kirche versteht. Wenn es stimmt, dass wir Christen die Schriften manchmal falsch interpretiert haben, müssen wir heute mit Nachdruck zurückweisen, dass aus der Tatsache, als Abbild Gottes erschaffen zu sein, und dem Auftrag, die Erde zu beherrschen, eine absolute Herrschaft über die anderen Geschöpfe gefolgert wird. […] Während «bebauen» kultivieren, pflügen und bewirtschaften bedeutet, ist mit «hüten» schützen, beaufsichtigen, bewahren, erhalten, bewachen gemeint. Das schliesst eine Beziehung verantwortlicher Wechselseitigkeit zwischen dem Menschen und der Natur ein. Jede Gemeinschaft darf von der Erde das nehmen, was sie zu ihrem Überleben braucht, hat aber auch die Pflicht, sie zu schützen und das Fortbestehen ihrer Fruchtbarkeit für die kommenden Generationen zu gewährleisten.»
Der christliche Glaube betrachtet die Welt als Schöpfung Gottes, die es zu bewahren gilt. Der Mensch erhält in diesem Kontext eine spezielle Rolle, ist aber aufgerufen, sorgsam mit seiner Mitwelt umzugehen und sich aktiv für deren Erhalt einzusetzen. Wird alles Geschaffene als Geschenk Gottes betrachtet, ermöglicht das einen Perspektivenwechsel und einen Umgang gegenüber allem Geschaffenen in Ehrfurcht, Achtsamkeit, Würde und Respekt. Denn alles wird nicht nur zu einem kostbaren Geschenk Gottes, sondern die Menschen werden eingeladen, «die Natur als prächtiges Buch zu erkennen, in dem Gott zu uns spricht und einen Abglanz seiner Schönheit und Güte aufscheinen lässt» (Laudato Si‘ 12).
Dazu gehört auch die Spiritualität des Franz von Assisi, einem der wichtigsten Heiligen der katholischen Kirche. Der Bezug des Menschen zur Schöpfung erhält einen zentralen Wert. Franz von Assisi sah in der gesamten Natur eine Ausdrucksform der göttlichen Liebe und forderte einen respektvollen Umgang mit allen Geschöpfen.
Glaube und Hoffnung in schwierigen Zeiten
Der Glaube kann einerseits wichtige Voraussetzungen schaffen, sich für den Einsatz gegen den Klimawandel und für den Erhalt der Biodiversität zu engagieren. Er kann damit zu einer besonders tiefliegenden und stark verankerten motivationalen Kraft werden. Dies ist auch die Voraussetzung dafür, angesichts globaler Umweltkrisen auch in schwierigen Zeiten zukunftsorientiertes Handeln zu ermöglichen. Der Glaube kann Menschen dazu inspirieren, sich trotz der Herausforderungen für den Schutz der Schöpfung einzusetzen. Die Bewahrung der Schöpfung ist nicht nur eine ethische Verpflichtung, sondern auch eine Chance, durch gemeinsames Engagement Hoffnung zu stiften und eine lebenswerte Zukunft für kommende Generationen zu sichern.
Auch Religionsgemeinschaften haben Luft nach oben
In vielen Religionen gibt es motivationale Ansätze für den Einsatz gegen den Klimawandel und für den Erhalt der Biodiversität. Religionsgemeinschaften agieren gleichzeitig auch im aktuellen gesellschaftlichen Kontext. Soziale oder wirtschaftliche Fragen können höhere Priorität geniessen. In einem westeuropäischen Kontext stehen Glaubensgemeinschaften ausserdem vor der Herausforderung, religiöse Leitgedanken nicht dogmatisch an eine Gesellschaft zu richten, die sich individuell und freiheitlich definiert und Eigenverantwortung hochhält. Vor diesem Hintergrund wirkt der Aufruf zu Nachhaltigkeit als neuer moralischer Fingerzeig, der die Kirchen als Institutionen mit sinkenden Mitgliederzahlen auf eine neue Weise unbequem macht. Hinzu kommt, dass aufgrund von Skandalen für viele Menschen Religionsgemeinschaften als moralische und ethische Werteträger an Bedeutung eingebüsst haben.